Ein Beziehungsberater ist kein Richter und eine Beziehungsberatung kein Gerichtsprozess. Obgleich dies wohl allen meinen Klienten klar sein dürfte, erlebe ich es immer wieder, dass jede(r) dem/der anderen die Schuld gibt an der schwierigen Beziehung, die aber vom anderen verständlicherweise nicht angenommen wird. Für solch eine Dynamik, die zu nichts führt, als zu noch mehr Verdruss, braucht man kein Geld bei einem Beziehungsberater ausgeben – das kann man zu Hause billiger haben. Wie aber kann die Kraft die der Paardynamik inne wohnt stattdessen zielführend ausgerichtet werden?
Wer Schuld hat, hat etwas falsch gemacht, der andere der keine Schuld hat, hat alles richtig gemacht – so das Konzept. Kein Wunder also, dass immer der/die andere Schuld haben soll, damit wir selbst alles richtig gemacht haben. Das fühlt sich einfach besser an. Für meine(n) Partner(in) allerdings auch und so wird der schwarze Peter immer hin und her geschoben und nichts bewegt sich, oder wenn, dann abwärts.
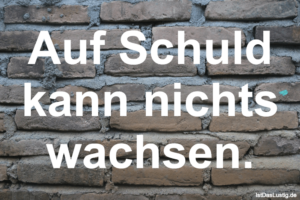 Da Sie bei der Beziehungsberatung aber nicht vor Gericht stehen, ist die Frage nicht, wer hat Schuld, was macht mein Partner falsch, und auch nicht was mache ich falsch, sondern was bewirkt mein Tun bei meinem Gegenüber. Und sein/ihr Tun bei mir. Während erstere Fragen ein Fehlverhalten unterstellen und damit „automatisch“ zu Abwehr führen, ist die letztere eine Forschungsfrage, die uns Auskunft gibt, wie die Zahnräder im „paardynamischen Getriebe“ ineinandergreifen.
Da Sie bei der Beziehungsberatung aber nicht vor Gericht stehen, ist die Frage nicht, wer hat Schuld, was macht mein Partner falsch, und auch nicht was mache ich falsch, sondern was bewirkt mein Tun bei meinem Gegenüber. Und sein/ihr Tun bei mir. Während erstere Fragen ein Fehlverhalten unterstellen und damit „automatisch“ zu Abwehr führen, ist die letztere eine Forschungsfrage, die uns Auskunft gibt, wie die Zahnräder im „paardynamischen Getriebe“ ineinandergreifen.
Es ist ganz praktisch betrachtet also nicht die Frage, ob es falsch oder richtig ist, die berühmte Zahnpasta Tube offen zu lassen, sondern was es bei meinem Gegenüber bewirkt, wenn ich das tue und aus welchem Grund ich es tue bzw. lasse.
Von der Schuld zur Verantwortung
Wenn es nicht mehr um die Schuldfrage geht, nicht mehr um ein Fehlverhalten, erst dann können wir uns bewegen, weil wir uns nicht mehr verteidigen müssen. Die Frage nach der Schuld lässt uns automatisch in eine Abwehrhaltung und Blockade gehen. Durch dies Verteidigungsbarrikaden verbauen wir und selbst und der/dem anderen den Weg aufeinander zu. Den Weg zu Wohlwollen und Verständnis für die Position des anderen.
Machen sie den Test: Überlegen Sie, ob Sie schon jemals durch Schuldzuweisungen an den/die Partner(in) eine Situation in ihrem Sinne verbessern konnten?
Statt „Du hast Schuld“ wäre der Weg, den ich meinen Klienten bei der Beratung nahelege und auch mit ihnen übe ein anderer: Wir übernehmen jeweils die Verantwortung für unser eigenes Handeln, unser eigenes Tun und Lassen und für die daraus entstehende Dynamik. Ich mach mir also bewusst, dass mein Handeln auch das Handeln meines/r Partner(in)* beeinflusst und dessen Agieren wiederum Einfluss auf mein eigenes Handeln hat. Für die Dynamik ist es dabei übrigens völlig unerheblich, ob zuerst die Henne oder das Ei da war.
Die Schuld –Tradition
Während Schuld also eng mit Fehlverhalten verbunden ist und daher zu Abwehr führt ist Verantwortung nicht wertend, im Gegenteil oft positiv besetzt. Denn wer Verantwortung übernimmt, kann handeln, Dinge zum besseren verändern und aus der machtlosen, wenn auch oft bequemen, schuldzuweisenden Opferrolle aussteigen. 
Das Wort „Schuld“ durch Verantwortung zu ersetzen ist dann also vielmehr als reine Wortkosmetik, wenn damit auch die beschriebene Veränderung der inneren Haltung einhergeht.
Zugegeben, eine innere Haltung zu ändern ist nie einfach und meist ein längerer Prozess. Dies trifft bei umso mehr zu, wenn man in einem System sozialisiert wurde, in dem Schuld und Strafe eine ganz selbstverständliche Rolle spielen, wie dies in unserer christlich – abendländischen Kultur nun mal der Fall ist. Alle Rechtsysteme und Religionen fußen auf diesem Gedankengut. Eine Welt ohne Schuld und Strafe ist kaum vorstellbar, vielleicht auch nicht praktikabel. Wäre es vor diesem Hintergrund aber nicht umso wünschenswerter, wenn wir uns in unserem nächsten persönlichen Umfeld eine Insel schaffen könnten, auf der die Frage der Schuld zumindest etwas in den Hintergrund tritt und durch selbstermächtigende Verantwortung ersetzt wird?
Wenn Sie per mail auf neue Blog-Beiträge aufmerksam gemacht werden wollen, melden Sie sich bitte oben links an






